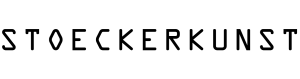Bickendorfforschungen – Untersuchungen im Veedel
Gefördert durch das Land NRW
Seit mehreren Jahren untersuche ich fotografisch das Narrativ dieses Kölner Viertels. Ich wohne dort.
Die Wirklichkeit ist interessanter als jede Fiktion.
Hieronymiepark November 2023
Hieronymiepark Mai 2024
Hieronymiepark Januar 2025
Hieronymiepark Februar 2025
23.02.2025